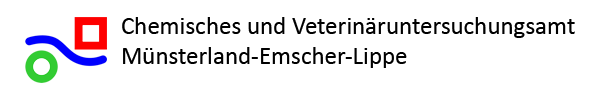In der Nutztierhaltung kann auf den Einsatz von Arzneimitteln, genau wie in dem Bereich der Humanmedizin, nicht vollständig verzichtet werden.
Die Behandlung sollte jedoch auf das für die Gesunderhaltung der Tiere notwendige Maß beschränkt werden. Aus diesem Grund werden die gesetzlich festgelegten Grenzwerte und die Einhaltung von Anwendungsverboten überwacht.
Zum Schutz der Verbraucher sind europaweit einheitliche Höchstmengen in EU-Verordnungen, z.B. in der Verordnung (EG) Nr. 470/2010, festgelegt worden. Diese beziehen sich auf Tierarzneimittelrückstände in unterschiedlichen Lebensmitteln tierischer Herkunft. Für manche Tierarzneimittel, wie z.B. Hormone, die als Masthilfsmittel missbräuchlich eingesetzt werden können, ist der Einsatz verboten. Neben dem Verbraucherschutz spielt hierbei auch der Tierschutz eine wichtige Rolle.
Der Nationale Rückstandskontrollplan
Seit 1989 besteht der Nationale Rückstandskontrollplan (NRKP). Dabei handelt es sich um ein Programm zur Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft auf Rückstände gesundheitlich unerwünschter Stoffe. Der NRKP wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) jährlich neu erstellt und in der gesamten Europäischen Union nach festgelegten Maßstäben durchgeführt. Grundlage für die Erstellung des Nationalen Rückstandskontrollplans sind die Europäische Richtlinie 96/23/EG und die Europäische Entscheidung 97/747/EG. Die Probenahme erfolgt größtenteils direkt im Schlachthof. Die Anzahl der zu untersuchenden Proben richtet sich nach den Schlachtzahlen des Vorjahres. Ein Teil der Proben wird jedoch auch direkt beim Erzeuger, dem Landwirt, entnommen. Hier richtet sich die Anzahl der zu entnehmenden Proben nach der Produktionsmenge oder den Tierbestandszahlen des Vorjahres. Insgesamt sind mehr als die Hälfte der untersuchten Tiere Schweine; gefolgt von Rindvieh, Geflügel, Schafen, Ziegen und Pferden. Darüber hinaus werden z.B. Wildtiere, Fische aus Aquakultur und Kaninchen beprobt. Neben den Lebensmitteln, z.B. Muskelfleisch, Milch und Eiern, werden auch verschiedene Organe und Gewebe untersucht, in denen sich die zu untersuchenden Substanzen anreichern, wie z.B. die Retina des Auges. Insgesamt werden jährlich etwa 14.000 NRKP-Proben in ganz NRW untersucht, davon ca. 6.500 Proben im CVUA-MEL. Das Untersuchungsspektrum umfasst u.a. die nicht zugelassenen oder verbotenen Stoffgruppen Stilbene, Thyreostatika, Steroide und β-Agonisten sowie die größtenteils mit Höchstmengenbeschränkungen zugelassenen Antibiotikagruppen Aminoglykoside, β-Lactamantibiotika (Penicilline und Cephalosporine), Makrolide und Sulfonamide.
Tierarzneimittelanalytik
Zur Untersuchung von Tierarzneimittelrückständen werden teilweise zunächst Screeningverfahren eingesetzt. Diese haben den Vorteil, dass viele Proben in kurzer Zeit und mit relativ geringem Aufwand untersucht werden können, um auffällige Proben, im Sinne von erhöhten Tierarzneimittelrückständen, heraus zu filtern. Die Proben, die sich im Screening als auffällig erwiesen haben, werden dann mit Bestätigungsmethoden weiter untersucht, z.B. mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (kurz: LC-MS/MS), um das Ergebnis qualitativ und quantitativ abzusichern. Tierarzneimittelrückstände können von uns auch im Spurenbereich (µg/kg bzw. ng/kg) sicher nachgewiesen werden.